- Basel-Landschaft
- Organisation
- Direktionen
- Sicherheitsdirektion
- Amt für Migration, Integration und Bürgerrecht
- Fachabteilung Integration
- Newsletter
- Ausgabe Juni 2021
- Perspektiven: Neues Wir
Perspektiven: Neues Wir
Rohit Jain ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Eidgenössischen Migrationskommission EKM und Programmverantwortlicher für das Projekt «Neues Wir». Ein Interview über "Wir und die Anderen".
Interview: FIBL, Foto: Rohit Jain
FIBL: Auf dem Cover der letzten Ausgabe von «terra cognita» (Herbst 2020) fragte die Eidgenössische Migrationskommission EKM «Wer ist Wir?». Was ist Ihre persönliche Antwort darauf?
Rohit Jain: Die Schweiz ist schon lange eine Migrationsgesellschaft, ohne dies anzuerkennen. Meine Eltern kamen in den späten 1960er Jahren aus Indien in die Schweiz. Die Fremdenfeindlichkeit und der Assimilationsdruck von damals haben meine Kindheit geprägt. Ich bin in einer kleinen Agglomerationsgemeinde bei Bern aufgewachsen und habe immer versucht mich anzupassen. So habe ich mich etwa geschämt, Hindi zu sprechen und auch in der Schule wurde den Eltern quasi verboten, zuhause mit den Kindern ihre Muttersprache zu sprechen. Heute höre ich immer wieder: «Das ist aber schade, dass Du mit Deinen Kindern nicht Hindi sprichst, das wäre doch eine Riesenchance!» Zuerst fand ich das recht absurd, da ich mich ja assimilieren sollte. Zunehmend hatte ich jedoch den Eindruck, dass viele Schweizerinnen und Schweizer ohne Migrationshintergrund relativ naiv sind und wenig über ihre eigene Gesellschaft und ihre Mitmenschen mit Migrationshintergrund wissen. Heute fühle ich mich voll und ganz in meiner Mehrfachzugehörigkeit und Mehrsprachigkeit zuhause. Meine Antwort lautet daher: Wir sind Viele, und wir können stolz darauf sein. Aber wir müssen als Gesellschaft noch ein Bewusstsein dafür kriegen. Dies erfordert, dass migrantische Wirklichkeiten und Stimmen sichtbarer werden und als Teil der Schweiz anerkannt werden.
 Bild Legende: Rohit Jain
Bild Legende: Rohit JainRohit Jain
Der Sozialanthropologe Rohit Jain ist bei der Eidgenössischen Migrationskommission EKM Verantwortlicher für das Programm «Neues Wir». Daneben ist er assoziiert am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich und organisiert rassismuskritische Kultur-Events.
Sehen Sie diese Wahrnehmung auch in ähnlicher Form in öffentlichen Diskussionen (z.B. Medien oder Politik) widerspiegelt? Wie nehmen Sie die Darstellung des «Wir» dort wahr?
In den Medien, in der Kultur und in der Öffentlichkeit wird öfter «über» Menschen mit Migrationshintergrund geschrieben, berichtet und erzählt – insbesondere als Problem – als «von» ihnen. Bei der Berichterstattung im Radio oder Fernsehen zu Abstimmungen wird der Widerspruch offenkundig. Es heisst oft: «Wir stimmen an diesem Wochenende über xyz ab….». Dabei sind 25% der Bevölkerung nicht zugelassen zu Abstimmungen, weil die Einbürgerungsschranken im europäischen Vergleich mit die höchsten sind. Das heisst, dass diese 25% in dieser Berichterstattung auch nicht angesprochen sind. Und das ist nur eines von zig Beispielen. Viele Menschen mit Migrationshintergrund denken daher: «Ich werde ja sowieso nie dazugehören». Gerade für Kinder und Jugendliche ist diese Erfahrung prägend. Sie kann über die Jahre die Motivation schwächen, sich am öffentlichen Leben zu beteiligen, das Beste in Bildung oder Arbeit zu geben oder sich gar einbürgern zu lassen. Das ist nicht deren Problem, sondern das der gesamten Gesellschaft. Die Anerkennung eines neuen, vielstimmigen «Wir» würde es erlauben, Chancengerechtigkeit zu stärken und Potentiale zu nutzen.
Die Schweiz als Bundesstaat hat die sprachliche, konfessionelle und kulturelle Vielfalt quasi in ihrer DNA. Sie hat es geschafft, unterschiedliche Interessen/Kräfte bei der Staatsgründung zu berücksichtigen. Wieso tut sie sich heute dennoch manchmal schwer mit ihrer Rolle als Einwanderungsland?
Die Schweiz versteht sich als föderalistische und mehrsprachige Willensnation. In ihrer Vergangenheit schaffte sie es tatsächlich, politische, religiöse und sprachliche Minderheiten einzubeziehen. Diese demokratische Tradition gilt es in der heutigen Migrationsgesellschaft mutig und ohne Verlustängste weiterzuführen. Zurzeit gibt es im Schweizer Selbstbild aber immer noch zwei Arten der Vielfalt: Die regionalsprachliche Vielfalt wird seit Anfang des Bundestaats und dann vor allem in der Geistigen Landesverteidigung als Teil des nationalen «Wir» anerkannt. Daher wird sie durch Kultur- und Sprachpolitik gefördert. Die andere, migrantische Vielfalt wird nicht als Teil des nationalen «Wir» verstanden, wenn sie auch seit über einem Jahrhundert die Schweiz prägt. Sie wird seit 1931 im Ausländerrecht reguliert und darin als Problem definiert, das (früher) durch Assimilation und (heute) durch Integration bewältigt werden soll. Und das ist bis heute so. Mit dem Programm «Neues Wir» möchten wir stattdessen einen kulturellen Wandel im öffentlichen Selbstbild anstossen und sichtbar machen, dass die Willensnation Schweiz schon längst vielsprachig ist, und nicht nur viersprachig.
Das Förderprogramm «Neues Wir» der EKM zielt unter anderem darauf ab, stereotype Bilder, Räume, Geschichten oder Diskurse von «Wir und die Anderen» zu hinterfragen und Alternativen dafür zu entwickeln. Haben Sie Beispiele dafür, wie das in eher ländlichen Kantonen konkret aussehen könnte?
Mit dem Förderprogramm «Neues Wir» bezwecken wir die kulturelle Teilhabe in der Migrationsgesellschaft zu stärken. Alle Menschen in der Schweiz, so die Grundannahme des Programms, sind Alltagsexpertinnen und Alltagsexperten für die Migrationsgesellschaft Schweiz – ob sie nun selbst über einen Migrationshintergrund verfügen oder nicht. Denn im Alltag, auf den Pausenhöfen, in den Supermärkten, bei der Arbeit, in den Medien und in der Familie sind alle mit den Potentialen und Herausforderungen von Migration und Vielfalt konfrontiert – in belebten Stadtquartieren ebenso wie in ländlichen Gewerbezentren oder in Bergdörfern. Der Fokus auf ländliche Kantone ist uns sehr wichtig. Im Projekt «Ohren auf Reisen» entwickeln etwa Menschen von nah und fern gemeinsam Hörstücke zum Thema Heimat, die u.a. im Emmental oder Entlebuch präsentiert und diskutiert werden.
Ist ein «Wir» ohne «die Anderen» überhaupt möglich? In der Region Basel hat beispielsweise die Fasnacht eine lange Tradition. Für viele Menschen ist sie identitätsstiftend, gleichzeitig kann sie auch ausschliessen. So gibt es immer wieder Debatten zum Umgang mit Sujets oder Schnitzelbänken, die sich beispielsweise über Ausländerinnen und Ausländer lustig machen und so Stereotype zementieren. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie von solchen Diskussionen hören?
Ich finde es sehr wichtig, dass wir als Gesellschaft solche Diskussionen offen und ehrlich führen. Die Schweizer Öffentlichkeit ist noch nicht sehr erfahren darin, und viele traditionsbewusste Schweizerinnen und Schweizer sind bei Kritik schnell beleidigt oder irritiert. Aber es geht nicht darum, ihnen etwas wegzunehmen. Gleichzeitig kann es doch auch nicht sein, Stereotypisierungen und zum Teil offen rassistische Aussagen als Teil der Tradition zu schützen. Soll das heissen, dass man als Mensch mit Migrationshintergrund oder of Color nur zugehörig sein kann, wenn man sich zuerst beleidigen oder auslachen lässt? Ich würde behaupten, dass Traditionen dazu da sind, gesellschaftlichen Wandel zu reflektieren und darauf zu reagieren. Eine demokratische Gesellschaft wie die Schweiz muss solche Diskussion auf «Augenhöhe» führen können, ohne dass Menschen mit Migrationshintergrund oder of Color nur Bittstellerinnen und Bittsteller sind. Wäre es sogar möglich, die Fasnacht zeitgemässer und vielstimmiger zu machen, in dem migrantische Stimmen und Themen sichtbarer werden? Wir unterstützen ein spannendes Projekt in Fribourg, dass dies im Rahmen des Volksfestes des Saint Nicolas versucht.
Wo sehen Sie die Rolle der Integrationsförderung oder der öffentlichen Verwaltung allgemein wenn es darum geht, Stereotypen abzubauen resp. das «Neue Wir» zu etablieren?
Die Integrationsfachstellen nehmen eine wichtige Rolle ein. Sie versammeln zurzeit viel Knowhow und Kompetenzen, um Gesellschaft und Regelstrukturen wie Verwaltungen, Bildung, Kultur, Arbeitswelt oder Gesundheit zu Integrationsfragen zu sensibilisieren. Zunehmend wäre es aber auch wichtig, die interkulturelle Öffnung dieser Institutionen voranzutreiben, also die Diversität und den Diskriminierungsschutz zu stärken. Das würde konsequenterweise eine Abkehr von einem «Integrationsverständnis» erfordern, in dem «Wir» die «Anderen» integrieren. Stattdessen müsste es den Willen geben, in den Institutionen die gesellschaftliche Vielfalt abzubilden. Das ist ein weiter Weg, aber er ist unaufhaltsam und wir haben ihn schon beschritten
Neues Wir
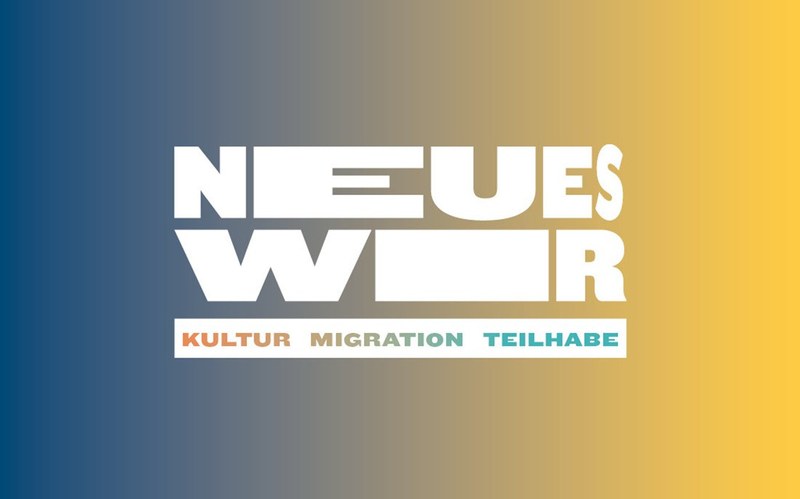
«Neues Wir»
Im Programm werden partizipative Projekte gefördert, die Diskurse, Bilder, Geschichten und Räume von «Wir und die Anderen» hinterfragen und Alternativen dazu entwickeln. Das neue Programm stärkt damit die kulturelle Teilhabe, die soziale Kohäsion und ein vielstimmiges Wir-Gefühl in der Migrationsgesellschaft Schweiz.
Eidgenössische Migrationskommission EKM
Die EKM hat den gesetzlichen Auftrag, sich mit sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, politischen, demografischen und rechtlichen Fragen zu befassen, die sich aus dem Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz ergeben. Die behandelten Themenfelder reichen vom Flüchtlingsschutz und der Arbeitsmigration über den sozialen Zusammenhalt bis hin zu transnationalen Fragestellungen.